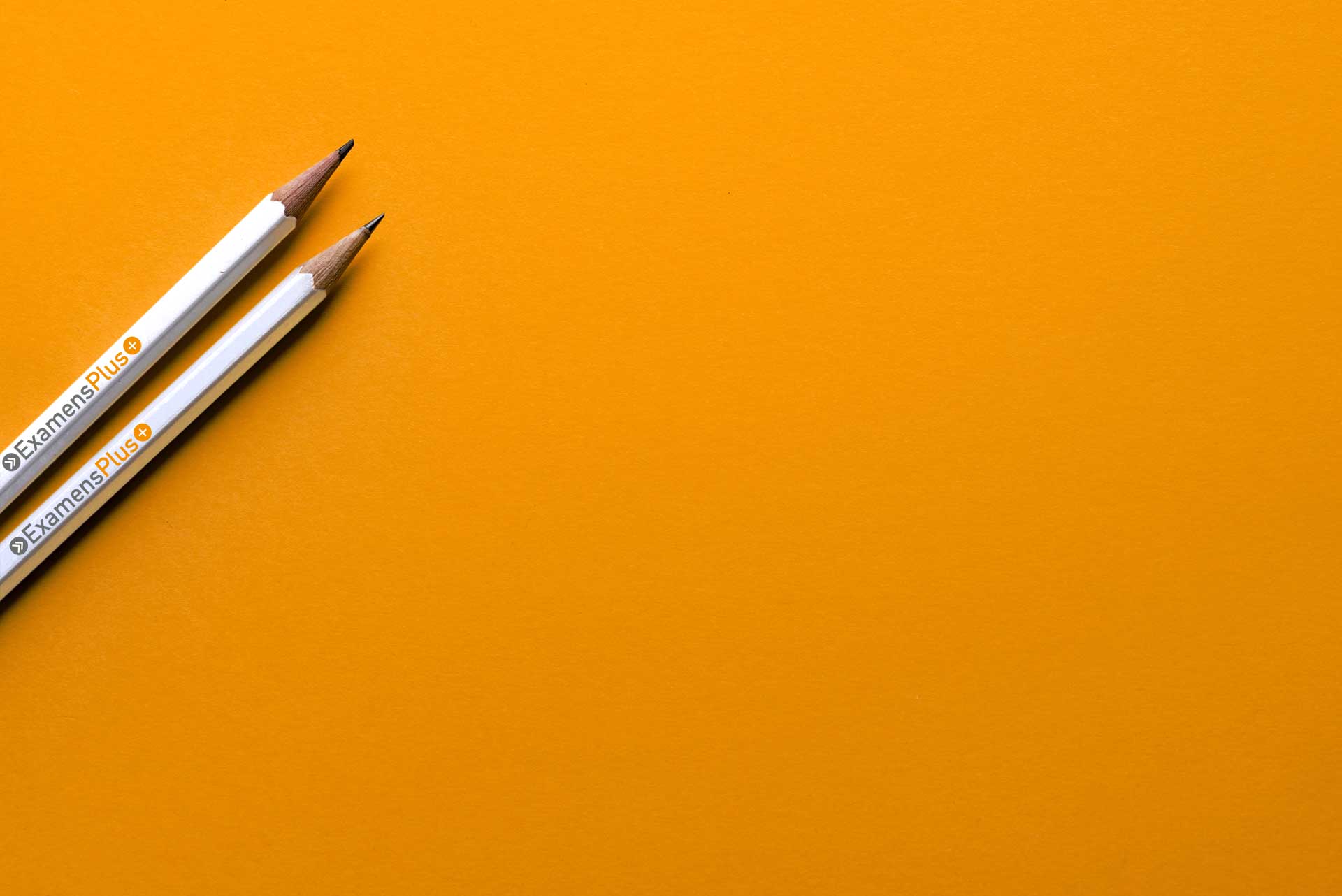Das Repetitorium für Referendare
Wir bringen Examensnähe in die Anwaltsstation
Konzept
Wir sind spezialisiert auf Inhouse-Seminare zur kompakten und effizienten Vorbereitung auf das Assessorexamen in allen drei Rechtsgebieten. Das Ziel ist stets, den Teilnehmern das zu vermitteln, was in den Klausuren gefragt ist:
praxistaugliche Lösungswege mit der richtigen Schwerpunktsetzung.
„Anwaltskanzleien, die sich der Nachwuchsförderung besonders verpflichtet fühlen und ihren Referendaren einen echten Mehrwert in der Ausbildung bieten möchten, bauen auf die Kurse von ExamensPlus.“
Unsere Kurse finden in den Räumen der Kanzleien statt und sind auf deren übrige Ausbildung abgestimmt. Wir wiederholen und vertiefen die Strukturen des für das Assessorexamen so zentralen Prozessrechts, festigen das Verständnis für Zusammenhänge und behandeln die klassischen examensrelevanten Probleme ebenso wie aktuelle Rechtsprechung.
„Zu Übungszwecken überladene Fälle, die den Respekt vor dem Examen mehr fördern als das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, gibt es bei uns nicht.“
Dozenten
Der konsequenten Ausrichtung auf die Anforderungen des Praktikerexamens entspricht es, dass unsere Seminare ausschließlich von erfahrenen Praktikern gehalten werden, die zugleich über langjährige Erfahrung in der Juristenausbildung verfügen. Aktuelle Rechtsentwicklungen kennen sie aus der täglichen Arbeit. Die Fähigkeit, mit dem Blick von Referendaren auf einen Fall zu schauen, haben sie sich durch ihre beständige Tätigkeit als Dozenten bewahrt.

Zivilrecht
Dr. Tino Vollmar
Richter am Amtsgericht Köln
![]() Langjähriger Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften, zuvor Tätigkeit als Repetitor für einen bundesweiten Anbieter
Langjähriger Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften, zuvor Tätigkeit als Repetitor für einen bundesweiten Anbieter
![]() Lehrbeauftragter der Hochschule des Bundes für den Bereich des Zivilrechts 2018
Lehrbeauftragter der Hochschule des Bundes für den Bereich des Zivilrechts 2018
![]() Tätigkeit für die Rechtsanwaltskammer Köln in der Weiterbildung von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten seit 2016
Tätigkeit für die Rechtsanwaltskammer Köln in der Weiterbildung von Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten seit 2016
![]() Dozent für den Kölner Anwaltverein und den Deutschen Anwaltverein seit 2011
Dozent für den Kölner Anwaltverein und den Deutschen Anwaltverein seit 2011
![]() Dozent für die Polizeiakademie (LAFP) des Landes Nordrhein-Westfalen seit 2019
Dozent für die Polizeiakademie (LAFP) des Landes Nordrhein-Westfalen seit 2019

Öffentliches Recht
Dr. Michael Ott
Vors. Richter am Verwaltungsgericht Köln
![]() Langjähriger Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften, zuvor Tätigkeit als Repetitor für einen bundesweiten Anbieter
Langjähriger Leiter von Referendararbeitsgemeinschaften, zuvor Tätigkeit als Repetitor für einen bundesweiten Anbieter
![]() Abordnung an das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 2016
Abordnung an das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen 2016
![]() Abordnung an die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen (Referent für Verfassungs- und Europarecht) von 2011 bis 2013
Abordnung an die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen (Referent für Verfassungs- und Europarecht) von 2011 bis 2013
![]() Lehrbeauftragter der Hochschule für öffentliche Verwaltung NRW 2009
Lehrbeauftragter der Hochschule für öffentliche Verwaltung NRW 2009
![]() Mitautor des Handbuchs „EU-Recht in der Praxis“; Autor des Kapitels „Diskriminierungsverbote“, in: Fischer (Hg.), EU-Recht für Verwaltung und Justiz.
Mitautor des Handbuchs „EU-Recht in der Praxis“; Autor des Kapitels „Diskriminierungsverbote“, in: Fischer (Hg.), EU-Recht für Verwaltung und Justiz.

Strafrecht
Daniela Fuchs
Oberstaatsanwältin in Köln
![]() Langjährige Leiterin von Referendararbeitsgemeinschaften
Langjährige Leiterin von Referendararbeitsgemeinschaften
![]() 2017 bis 2022 abgeordnet zum Generalbundesanwalt in Karlsruhe
2017 bis 2022 abgeordnet zum Generalbundesanwalt in Karlsruhe
![]() Tätigkeit als Strafrichterin am Amtsgericht
Tätigkeit als Strafrichterin am Amtsgericht
![]() Referententätigkeit bei der Justiz und Polizeibehörden
Referententätigkeit bei der Justiz und Polizeibehörden
Intensivkurse für Referendare
Kompakt effizient erfolgreich
Auch noch so gute Rechtskenntnisse helfen nicht weiter, wenn man sie in der Klausur nicht in eine
praktisch verwertbare Lösung umsetzen kann. Unsere Kurse setzen daher in besonderem Maße auch auf die Vermittlung des in jedem Fall unerlässlichen Handwerkszeugs.
Skripte
„Die Teilnehmer unserer Seminare erhalten exklusiv zu jedem Rechtsgebiet ein begleitendes ExamensPlus-Skript.“
Die Skripte sind mit dem Anspruch verfasst, das für das Examen notwendige prozessuale Wissen zum jeweiligen Rechtsgebiet anschaulich und konzentriert auf das, was sich ein Examenskandidat realistischerweise merken kann und sollte, auf den Punkt zu bringen. Zahlreiche Formulierungsbeispiele helfen dabei, die Schwachstellen vieler Referendare bei Aufbau und Stilfragen zu beheben.
„Die Seminare von ExamensPlus ergänzen und komplettieren damit die Ausbildung der Kanzleien, die zum Ziel hat, auf das Assessorexamen ebenso gründlich und gut vorzubereiten wie auf die Herausforderungen der Praxis.“
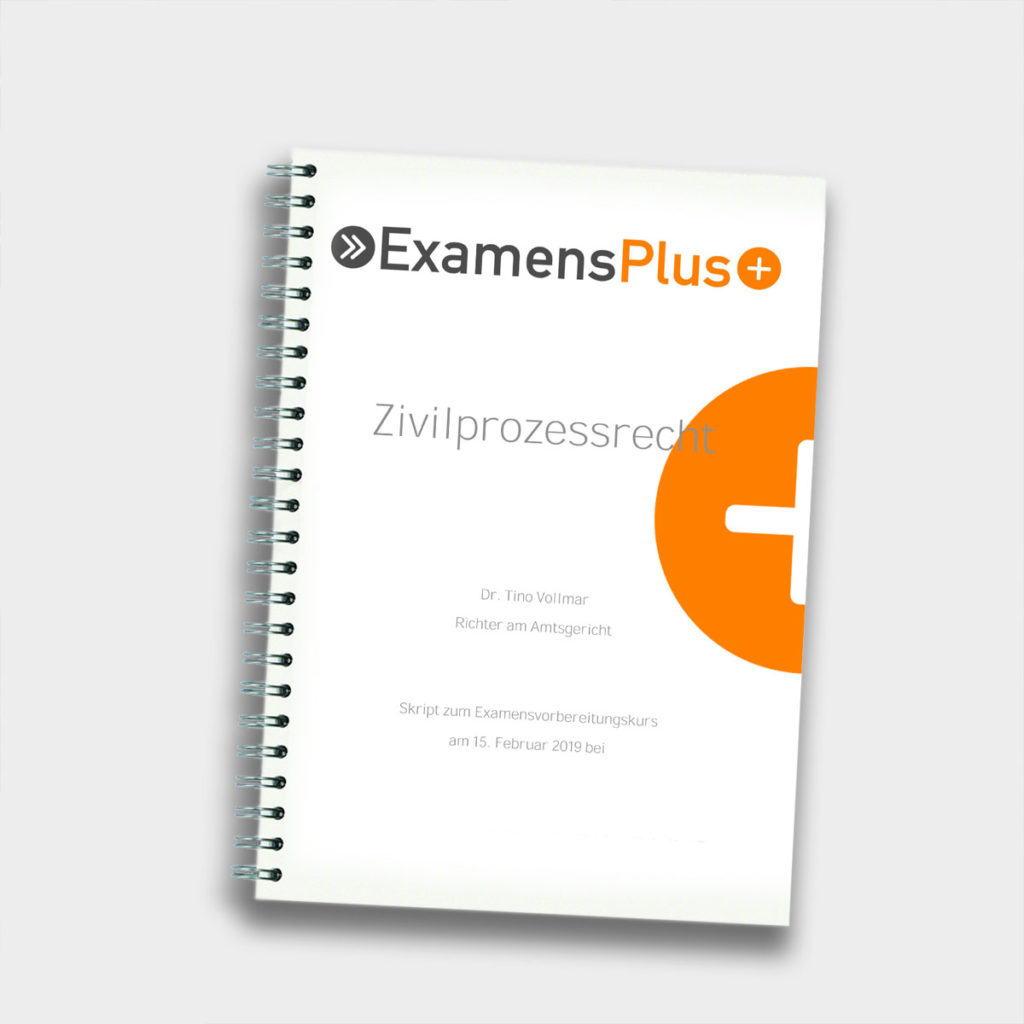
Examensrelevante Rechtsprechung
Zivilprozessrecht
Sachverhalt: Kl. bewohnte Einzimmerwohnung. Er begehrte vom Bekl. Zustimmung zur Untervermietung „eines Teils der Wohnung“ wegen berufsbedingter Abwesenheit. Einen Teil seiner Sachen sollten weiter in der Wohnung lagern. Kl. lagerte Sachen in einem Schrank, einer Kommode und in einem durch einen Vorhang im Flur abgetrennten Bereich von ca. einem Quadratmeter. AG wies Klage ab, LG gab Klage statt.
(P) Vermietet der Kl. hier nur „einen Teil des Wohnraums“ nach § 553 Abs. 1 BGB?
BGH: Dem Kläger steht ein Anspruch gemäß § 553 Abs. 1 BGB auf Gestattung der befristeten, teilweisen Gebrauchsüberlassung an den von ihm benannten Dritten zu.
BGH hat bereits in der Vergangenheit entschieden, dass die Vorschrift des § 553 Abs. 1 BGB weder quantitative Vorgaben hinsichtlich des beim Mieter verbleibenden Anteils des Wohnraums noch qualitative Anforderungen bezüglich der weiterer Nutzung durch den Mieter aufstellt.
Von einer Überlassung eines Teils des Wohnraums an einen Dritten im Sinne der Vorschrift des § 553 Abs. 1 BGB ist daher regelmäßig bereits dann auszugehen, wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht vollständig aufgibt.
Ein Ausschluss von Einzimmerwohnungen aus dem Anwendungsbereich der Bestimmung des § 553 Abs. 1 BGB ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut, der Gesetzesgeschichte noch aus dem mieterschützenden Zweck der Vorschrift. Letzterer liefe für Mieter einer Einzimmerwohnung andernfalls gänzlich leer.
Sachgerechte Gründe dafür, solche Mieter insoweit als weniger schutzwürdig anzusehen als Mieter einer Mehrzimmerwohnung, erschließen sich indes nicht, denn auch dem Mieter einer Einzimmerwohnung kann es, namentlich bei – wie hier – befristeter Abwesenheit, darum gehen, sich den Wohnraum zu erhalten.
Der Kläger hat seinen Gewahrsam an der Wohnung nicht vollständig aufgegeben. Denn er hat persönliche Gegenstände in der Wohnung in Bereichen zurückgelassen, die seiner alleinigen Nutzung vorbehalten waren, und sich den Zugriff hierauf zudem durch Zurückbehaltung eines Wohnungsschlüssels gesichert. Hinzu tritt der Wille des Klägers, die Wohnung nur für die Zeit seines Auslandsaufenthalts teilweise einem Dritten zu überlassen.
Sachverhalt: Kl. nimmt Bekl. 2014 wegen Ingenieurleistung in Anspruch. Die Ingenieurleistung aus dem Vertrag aus 2007 als solche wurde bereits mit Schlussrechnung abgerechnet und von der Bekl. erfüllt. Kl. hatte aber durch einen Fehler der Bekl. Mehraufwendungen i.H.v. 60.000,- EUR, die er im Wege des Schadensersatzes geltend macht. Er beantragt einen Mahnbescheid. In der Bezeichnung des Anspruchs beim Mahnbescheidsantrag schreibt er: „Anspruch aus Ingenieurvertrag vom 08.05.2007 – 60.000,- EUR“. Mit anwaltlichem Schreiben NEBEN dem Mahnverfahren teilt Kl. der Bekl. mit, dass demnächst ein Mahnbescheid eintreffen werde, mit der Schadensersatz für die näher bezeichneten Mehraufwendungen iHv. 60.000,- EUR geltend gemacht werde. Schreiben und Mahnbescheid gingen im Abstand von zwei Tagen bei Bekl. ein. Dies geschah im verjährungskritischen Zeitraum.
(P) Konnte die Zustellung des Mahnbescheids die Verjährung hemmen?
BGH: Verjährungshemmung durch Zustellung Mahnbescheid i.V.m. Anwaltsschreiben (+).
Nach § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB hemmt die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren die Verjährung. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH setzt die Hemmung der Verjährung voraus, dass der im Mahnbescheid bezeichnete Anspruch durch seine Kennzeichnung von anderen Ansprüchen unterschieden und abgegrenzt werden kann.
Damit der Schuldner beurteilen kann, ob er sich gegen den Anspruch zur Wehr setzen will oder nicht, muss er im Zeitpunkt der Zustellung des Mahnbescheids erkennen können, woraus der Gläubiger seinen Anspruch herleitet.
Die im Mahnbescheid nicht hinreichende Individualisierung des Anspruchs des Schuldners kann nachgeholt werden. Die Nachholung der Individualisierung hemmt die Verjährung nach § 204 Abs 1 Nr. 3 BGB zwar nicht rückwirkend, aber ab dem Zeitpunkt ihrer Vornahme. War zu diesem Zeitpunkt der mit dem Mahnbescheid geltend gemachte Anspruch noch nicht verjährt, wird mit der Nachholung der Individualisierung während des Mahnverfahrens die Verjährung nach § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB gehemmt.
Für die nachträgliche Individualisierung des Anspruchs im Mahnverfahren ist deshalb ebenso wie für die Individualisierung im Mahnbescheid ausschließlich auf den Erkenntnishorizont des Schuldners abzustellen. Dementsprechend ist es ohne Bedeutung, ob die Individualisierung des Anspruchs durch an das Gericht gerichteten Schriftsatz oder außerhalb des Gerichtsverfahrens erfolgt.
Spätestens mit der Zustellung des Schreibens der anwaltlichen Vertreter der Kl. konnte der Bekl. erkennen, woraus die Kl. den im Mahnbescheid bezeichneten Anspruch herleitete. Ab diesem Zeitpunkt war die Verjährung gehemmt.
Sachverhalt: Bekl. ist Immobilienmaklerin und offerierte dem Kl. eine Immobilie. In der Folge unterzeichneten die beiden einen „Reservierungsvertrag“, in dem die Bekl. als „Maklerin“ und der Bekl. als „Kaufinteressent“ bezeichnet wurde. Mit diesem Vertrag vereinbarten die Parteien die Reservierung der Immobilie für 420.000,- EUR bis zu einem bestimmten Datum. In dem Vertrag heißt es: „Die Reservierung kann für eine Gebühr von 4.200,- EUR verlängert werden. Bei Entstehen eines Provisionsanspruchs wird die Gebühr angerechnet. Sollte bis zum Ende der Reservierungszeit der Kaufvertrag nicht zustande kommen, so ist die Reservierungsgebühr nicht zurück zu erstatten. Mit der Reservierungsgebühr honoriert der Kaufinteressent die Verpflichtung des Maklers, während der Reservierungszeit die Immobilie exklusiv für den Kaufinteressenten anzubieten und/oder zu verkaufen.“ Ein Kaufvertrag kam nicht zustande. Der Kl. verlangt nun die gezahlten 4.200,- EUR zurück.
(P) Ist der „Reservierungsvertrag“ wirksam?
BGH: Kl. hat Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Reservierungsgebühr iHv. 4.200,- EUR. Der Reservierungsvertrag ist nach § 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam, weshalb dem Kl. ein Anspruch auf Rückzahlung der ohne Rechtsgrund geleisteten Reservierungsgebühr aus § 812 Abs. 1 S.1 Fall 1 BGB zusteht.
Der Reservierungsvertrag benachteiligt die Kaufinteressenten entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und ist daher nach § 307 Abs. 1, § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam.
Grds. findet eine Inhaltskontrolle nicht statt, wenn eine Abrede die Art, Umfang und Güte der vertraglichen Hauptleistung und der hierfür zu bezahlenden Vergütung unmittelbar regelt. Die Anwendung der AGB-Regeln scheitert hier aber nicht daran, dass der Reservierungsvertrag eine vom Maklervertrag zu trennende eigenständige Vereinbarung mit nicht nach § 307 ff. BGB kontrollfähigen Hauptleistungspflichten sei. Welche Pflichten das Wesen des Vertrags charakterisieren und damit Hauptleistungspflichten sind, ist durch Auslegung der betroffenen Vereinbarungen der Parteien zu ermitteln.
Der Reservierungsvertrag kann im Rahmen der ABG-rechtlichen Inhaltskontrolle nicht als eine gegenüber dem Maklervertrag eigenständige Vereinbarung angesehen werden; vielmehr handelt es sich dabei um eine den Maklervertrag ergänzende Regelung.
Die Beauftragung der beklagten Maklerin durch die Kl. diente dem Zweck, den Kl. eine Möglichkeit zum Abschluss eines Immobilienkaufvertrags nachzuweisen. Diese Maklerleistung stellt die eigentliche Hauptleistung der Bekl. dar.
Im Verhältnis dazu erweist sich die von den Parteien ebenfalls getroffene Reservierungsvereinbarung als bloße Nebenabrede.
Zwischen Makler- und dem Reservierungsvertrag eine unmittelbare Verbindung besteht und dass es sich bei der Reservierungsvereinbarung im Verhältnis zum Maklervertrag um eine unselbstständige Nebenabrede handelt, wird auch daraus deutlich, dass die Parteien im Eingang des Reservierungsvertrags als „Makler“ und „Kaufinteressent“ bezeichnet werden. In dem Reservierungsvertrag ist außerdem festgehalten, dass der Kaufinteressent mit der Reservierungsgebühr eine bestimmte Verpflichtung des Maklers (nämlich diejenige zu einem exklusiven Vorhalten der Immobilie) honoriert. Die macht ohne „Maklerhauptvereinbarung“ keinen Sinn.
Dieser Annahme steht auch nicht entgegen, dass der – auch als solcher bezeichnete – Reservierungsvertrag nicht „räumlich“ in den Maklervertrag aufgenommen, sondern in Form eines eigenständigen Vertragsdokuments abgeschlossen wurde.
Der Reservierungsvertrag hält der Inhaltskontrolle nicht stand, weil er die Kaufinteressenten iSv § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unangemessen benachteiligt.
Der Reservierungsvertrag stellt letztlich den Versuch der Bekl. dar, sich für den Fall des Scheiterns ihrer Vermittlungsbemühungen gleichwohl eine Vergütung zu sichern, ohne dass gewährleistet ist, dass sich für die Kunden aus dieser entgeltpflichtigen Reservierungsvereinbarung nennenswerte Vorteile ergeben oder seitens der Bekl. eine geldwerte Gegenleistung zu erbringen ist.
Zwar ist das Versprechen der Bekl., die Immobilie nicht mehr anderweitig anzubieten, für die Kaufinteressenten von einem gewissen Interesse. Allerdings lässt dieses Versprechen das Recht der Verkaufsinteressentin unberührt, ihre Verkaufsabsichten aufzugeben oder das Objekt ohne Einschaltung der Bekl. an Dritte zu veräußern. Die Kaufinteressenten haben damit einen nicht unerheblichen Betrag bezahlt, ohne im Gegenzug die Gewähr zu haben, das fragliche Objekt auch erwerben zu können.
Der Reservierungsvertrag widerspricht darüber hinaus auch deshalb iSd § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB dem Leitbild der gesetzlichen Regelung, weil die Kaufinteressenten der Bekl. das Reservierungsentgelt unabhängig davon schulden, ob sie die Immobilie später erwerben. Nach dem Zweck des Reservierungsvertrags und seinen wirtschaftlichen Auswirkungen kommt dies der Vereinbarung einer erfolgsunabhängigen (Teil-)Provision gleich, die die in AGB zugunsten von Maklern nach allgemeiner Ansicht unwirksam ist.
Sachverhalt: Verkehrsunfall zwischen LKW und Leasing-PKW. Bekl. 1) war Halter, Bekl. 2.) Fahrer des PKW. PKW stand im Eigentum der S-Leasing SE. Im Leasingvertrag heißt es unter 8.2: Für Untergang, Verlust, Beschädigung und schadensbedingte Wertminderung des Fahrzeugs und seiner Ausstattung haftet der Leasingnehmer der S-Leasing SE (…) ab Besitzübergang auch ohne Verschulden, jedoch nicht bei Verschulden der S-Leasing SE (…). Kl. ist Versicherung des LKW, die Schadensersatzansprüche der S-Leasing SE vollständig regulierte. Unfallhergang konnte nicht geklärt werden. Kl. verlangt von Bekl. nun im Rahmen von Gesamtschuldnerausgleich 50 % des von ihr gezahlten Betrages.
(P) Sind die Kl und die Bekl. Gesamtschuldner iSd. § 426 BGB?
BGH: Kl. und Bekl. sind vorliegend keine Gesamtschuldner. S-Leasing SE hat Anspruch gegen die Kl., nicht aber gegen die Bekl.
Ein Anspruch der Kl. auf Innenausgleich gem. § 426 I 1 BGB scheidet aus. Es fehlt an dem für einen Ausgleichsanspruch erforderlichen Gesamtschuldverhältnis zwischen den Parteien.
Gemäß § 421 S. 1 BGB haften mehrere Schuldner als Gesamtschuldner, wenn jeder von ihnen die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der Gläubiger die Leistung aber nur einmal zu fordern berechtigt ist. Erste Voraussetzung für die Annahme einer Gesamtschuld ist dementsprechend, dass sich der Anspruch des Gläubigers gegen verschiedene Personen richtet. Bereits hieran fehlt es im Streitfall:
S-Leasing SE hat Schadensersatzanspruch gegen Kl. aus § 7 StVG, 115 VVG aus Unfallgeschehen. S-Leasing SE musste sich insb. keine Betriebsgefahr zurechnen lassen, weil § 17 Abs. 2 StVG nur Haftung von HALTERN untereinander regelt. Nicht aber Haftung von NICHTHALTENDEM EIGENTÜMER. Auch aus § 9 StVG i.V.m. § 254 BGB ergibt sich keine Mithaftung, weil § 9 StVG Verschulden voraussetzt, was hier nicht festgestellt werden konnte.
Bekl. sind S-Leasing SE NICHT zum Schadensersatz verpflichtet.
Kein Anspruch aus § 7 bzw. § 18 StVG, weil dieser eine andere Sache, als die gehaltene Sache, voraussetzt. Die verschärfte Haftung des Kraftfahrzeughalters bezweckt nur, Dritte vor den ihnen aufgezwungenen Gefahren des Kraftfahrzeugbetriebs zu schützen. Von diesem Schutzzweck wird die Verletzung des Eigentums des Leasinggebers an dem dem Leasingnehmer überlassenen Fahrzeug bei dem Betrieb dieses Fahrzeugs nicht erfasst.
Kein Anspruch aus §§ 823, 831 BGB. Denn es fehlt an haftungsbegründenden Verletzungshandlung, da Unfallgeschehen „nicht aufklärbar“.
Kein Anspruch der S-Leasing SE aus §§ 280 Abs. 1, 278 BGB gegen Bekl. 1., da keine Pflichtverletzung. Denn Betrieb eines geleasten Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr kann für sich genommen nicht als Verletzung einer Pflicht aus dem Leasingvertrag qualifiziert werden. Auch keine Pflichtverletzung durch Bekl. 2, da nur Beschädigung des PKW keine Pflichtverletzung darstellt.
Kein Anspruch aus 8.2 des Leasingvertrages. Klausel ist dahingehend auszulegen, dass darin die Sach- und Gegenleistungsgefahr entsprechend der kaufrechtlichen Wertung des § 446 BGB auf den Leasingnehmer abgewälzt, nicht hingegen aber eine verschuldensunabhängige Schadensersatzpflicht des Leasingnehmers begründet wird.
Kein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung. Die Kl. hat nicht auf eine fremde Schuld, sondern auf die gegen sie gerichtete und in voller Höhe begründete Forderung der Leasinggeberin aus § 7 StVG, § 115 VVG geleistet.
Sachverhalt: Eine GmbH ist im Handelsregister von Berlin mit Sitz in Berlin eingetragen. Berlin hat mehrere Amtsgerichtsbezirke. Als Geschäftsanschrift ergibt sich aus dem Handelsregister „c/o Steuerberatungsgesellschaft XY, Taunusstr. 3, 60329 Frankfurt/Main“. Eine Gläubigerin möchte aus einem Vollstreckungsbescheid gegen die GmbH in eine Forderung vollstrecken und beantragt beim AG Frankfurt/Main einen PfÜB. Das AG Frankfurt/Main bat um Vortrag zur örtlichen Zuständigkeit, die „üblicherweise mit dem Ort der Eintragung identisch sei.“ Daraufhin beantragte die Gläubigerin die Abgabe an das AG Berlin-Charlottenburg als das örtlich zuständige Vollstreckungsgericht. Mit Beschluss verwies das AG Frankfurt nach Berlin. Doch auch das AG Berlin-Charlottenburg sah keine Zuständigkeit.
(P) Welches Gericht ist vorliegend das Vollstreckungsgericht?
OLG Frankfurt: Vollstreckungsgericht ist nach § 828 Abs. 2 ZPO das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Der allgemeine Gerichtsstand der Schuldnerin als juristischer Person wird gem. § 17 Absatz I ZPO durch ihren Sitz bestimmt. Der Sitz der Schuldnerin, einer GmbH, ist gem. § 4a GmbHG der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Das gilt auch, wenn sich der Verwaltungssitz an einem anderen Ort befindet. Notwendig ist die Angabe einer bestimmten Gemeinde im Inland.
Satzungsgemäßer Sitz der Schuldnerin ist, was durch den Handelsregisterauszug bestätigt wird, Berlin.
In Fällen, in denen eine Gemeinde – wie Berlin – in mehrere (Amts-) Gerichtsbezirke zerfällt, sich der satzungsmäßige Sitz einer GmbH aber in der Angabe der Gemeinde erschöpft, ist ein Sitz der Gesellschaft in allen erfassten Amtsgerichtsbezirken, hier in allen Amtsgerichtsbezirken in B, mit der Folge anzunehmen, dass die Gläubigerin das zuständige Gericht gem. § 35 ZPO auswählen kann. Die Ausschließlichkeit nach § 802 ZPO bezieht sich dann auf alle Gemeindegerichte.
Die Gläubigerin hat hier ihr Wahlrecht mit dem Antrag auf Verweisung an das AG Berlin-Charlottenburg ausgeübt.
Sachverhalt: Kl. kaufte von Bekl. Grundstück. Bekl. verkaufte aber an besser zahlenden Käufer. Bekl. wurde daraufhin durch Grundurteil verurteilt, der Kl. Schadensersatz in Höhe des entgangenen Gewinns zu zahlen.
(P) Bei der Höhe des Schadens ging es um die Frage, ob die Klägerin sich anderweitig erzielbare Gewinne abziehen lassen muss.
OLG Düsseldorf: Anderweitige Gewinnmöglichkeiten müssen vorliegend nicht in Abzug gebracht werden.
Eine etwaige Möglichkeit für die Kl., andere Grundstücke zu erwerben, zu bebauen und gewinnbringend zu veräußern, würde nicht notwendig eine andere Erwerbsmöglichkeit, sondern nur eine zusätzliche Erwerbsmöglichkeit darstellen.
Die Regelung des § 648 S. 2 BGB für den Werkvertrag sowie § 615 S. 2 BGB für den Dienstvertrag und die Überlegungen zu Füll- und Ersatzaufträgen sind nicht auf kaufrechtliche Konstellationen wie die vorliegende übertragbar. Eine Analogiebildung scheidet mangels einer Regelungslücke im Kaufrecht aus.
Eine Analogie passt nur auf Konstellationen, in denen der entgangene Gewinn eines Werkunternehmers, Dienstleisters oder einer auf ähnliche Weise nach Gewinn strebenden Person in Rede steht, wenn es also um Gewinnerwirtschaftung durch den Einsatz von Arbeitskraft geht.
Vorliegend hat die Bekl. aber keine Pflichten aus einem Werk-, Dienst- oder vergleichbaren Vertrag verletzt, sondern aus einem Kaufvertrag. In diesem Bereich wird der Gewinn nicht durch Einsatz von Arbeitskraft, sondern durch Einsatz von Kapital erwirtschaftet. Für eine Regelung wie in § 648 BGB oder in § 615 BGB fehlt es im Bereich des Kaufrechts am Regelungsbedarf und entsprechend an einer durch Analogiebildung zu schließenden Regelungslücke.
In dem vorliegenden Fall geht es nicht um die Gewinnerwartung durch persönliche Arbeitsleistung, sondern um die Gewinnerwartung durch einen Weiterverkauf.
Sachverhalt: Kl. erwarb von Bekl. Grundstück zur Bebauung mit Hotel. Sie verpflichtete sich zur Bepflanzung der Einfahrt bei Vermeidung einer Vertragsstrafe und unterwarf sich in notarieller Urkunde der sofortigen Vollstreckung. Einige Zeit nach Vertragsschluss erklärte die Kl. einen Teilrücktritt, weil sich auf einem Teilbereich des Grundstücks eine Mittelspannungsleitung befand. In Vorprozess verlangte Kl. wegen Teilrücktritt Schadensersatz und Feststellung des Annahmeverzugs. Bekl. klagte widerklagend auf restlichen Kaufpreis. Gericht wies Klage rechtskräftig ab und gab Widerklage statt. Im hier zu entscheidenden Prozess betreibt die Bekl. nun die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde. Die Kl. wehrt sich mit Vollstreckungsabwehrklage, weil durch Teilrücktritt die Grundlage für Vertragsstrafe entfallen sei.
(P) Musste im Rahmen der Vollstreckungsgegenklage abermals geprüft werden, ob die Kl. wirksam zurückgetreten ist obwohl dies schon rechtskräftig verneint wurde? Lag außerdem Präklusion nach § 767 Abs. 2 ZPO vor? LG und OLG bejahten Bindungswirkung bzgl. Wirksamkeit des Kaufvertrages und außerdem die Präklusionswirkung.
BGH: Die rechtskräftige Verurteilung zur Zahlung restlichen Kaufpreises in einem Vorprozess stellt nicht das Bestehen des Kaufvertrags mit Bindungswirkung für einen Folgeprozess fest; es handelt sich insoweit nur um die Feststellung einer Vorfrage, die nicht in Rechtskraft erwächst. Bindungswirkung also NICHT gegeben.
Das Berufungsgericht hat den Umfang der Rechtskraft der in den beiden Vorprozessen ergangenen Urteile (…) verkannt. Rechtsfehlerhaft geht es davon aus, es stehe aufgrund der rechtskräftigen Entscheidungen in den Vorprozessen verbindlich fest, dass der notarielle Kaufvertrag (…) wirksam und nicht wegen etwaiger Täuschungshandlungen der Beklagten oder Pflichtverletzungen des beurkundenden Notars ganz oder teilweise rückabzuwickeln oder nichtig sei.
Im Ausgangspunkt besteht eine der Wirkungen der Rechtskraft gemäß § 322 Abs. 1 ZPO in der Bindung des Gerichts an die Vorentscheidung, wenn die im ersten Prozess rechtskräftig entschiedene Rechtsfolge im nachfolgenden Rechtsstreit eine Vorfrage darstellt (…). Dagegen erwächst die Feststellung der Vorfragen aus dem Vorprozess nicht in Rechtskraft (…).
Urteile sind nach § 322 Abs. 1 ZPO der Rechtskraft nur insoweit fähig, als über den durch die Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs erwächst in Rechtskraft die in dem Urteil ausgesprochene Rechtsfolge, d.h. nur der vom Gericht aus dem vorgetragenen Sachverhalt gezogene Schluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen der beanspruchten Rechtsfolge, nicht aber die Feststellung der zugrundeliegenden präjudiziellen Rechtsverhältnisse oder sonstigen Vorfragen, aus denen der Richter seinen Schluss gezogen hat.
Dementsprechend stellt ein Urteil auf Leistung von Miet- oder Darlehenszinsen nicht das Bestehen des vertraglichen Grundverhältnisses rechtskräftig fest (…). Das eine Räumungsklage abweisende Urteil enthält keine Feststellung über das Bestehen oder die Nichtbeendigung des Miet- oder Pachtverhältnisses (…). Ebenfalls nicht in Rechtskraft nach § 322 Abs. 1 ZPO erwachsen die Feststellungen über die der Entscheidung zugrunde liegenden präjudiziellen Rechtsverhältnisse, wie etwa die Nichtigkeit eines Vertrags.
Zu deren abschließender Klärung steht den Parteien die nicht an ein besonderes Feststellungsinteresse anknüpfende Zwischenfeststellungsklage (§ 256 Abs. 2 ZPO) und im Übrigen die Feststellungsklage (§ 256 Abs. 1 ZPO) offen.
Rechtsfehlerhaft sind weiter die Erwägungen des Berufungsgerichts, mit ihren gegen das Urteil des Landgerichts (…) gerichteten Einwänden könne die Klägerin nicht gehört werden, da sie mit diesen nach § 767 Abs. 2 ZPO präkludiert sei.
Schon im Ansatz unzutreffend nimmt das Berufungsgericht an, dass eine etwaige Präklusion mit Einwendungen gegen das im Vorprozess ergangene Urteil überhaupt dazu führen könnte, dass der Klägerin die Berufung auf die Nichtigkeit des Grundstückskaufvertrags und die Wirksamkeit ihres Teilrücktritts verwehrt ist. § 767 Abs. 2 ZPO betrifft nur das zu dem Titel führende Verfahren und nicht andere Prozesse.
Erst recht greift die Präklusionswirkung des § 767 Abs. 2 ZPO nicht ein, wenn wegen einer vollstreckbaren notariellen Urkunde im Sinne von § 794 Abs. 1 Nr. 5 ZPO Vollstreckungsgegenklage erhoben wird. Denn § 797 Abs. 4 ZPO bestimmt, dass der Schuldner durch die vollstreckbare Urkunde nicht mit seinen Einwendungen gegen den materiell-rechtlichen Anspruch nach § 767 Abs. 2 ZPO ausgeschlossen wird, weil der Titel nicht mit materieller Rechtskraft ausgestattet ist. Daher ist die der Urkunde zugrunde liegende Forderung im Rahmen einer Vollstreckungsabwehrklage in vollem Umfang und ohne Veränderung der Beweislast zu überprüfen (…).
Sachverhalt: Eine GmbH ist im Handelsregister von Berlin mit Sitz in Berlin eingetragen. Berlin hat mehrere Amtsgerichtsbezirke. Als Geschäftsanschrift ergibt sich aus dem Handelsregister „c/o Steuerberatungsgesellschaft XY, Taunusstr. 3, 60329 Frankfurt/Main“. Eine Gläubigerin möchte aus einem Vollstreckungsbescheid gegen die GmbH in eine Forderung vollstrecken und beantragt beim AG Frankfurt/Main einen PfÜB. Das AG Frankfurt/Main bat um Vortrag zur örtlichen Zuständigkeit, die „üblicherweise mit dem Ort der Eintragung identisch sei.“ Daraufhin beantragte die Gläubigerin die Abgabe an das AG Berlin-Charlottenburg als das örtlich zuständige Vollstreckungsgericht. Mit Beschluss verwies das AG Frankfurt nach Berlin. Doch auch das AG Berlin-Charlottenburg sah keine Zuständigkeit.
(P) Welches Gericht ist vorliegend das Vollstreckungsgericht?
OLG Frankfurt: Vollstreckungsgericht ist nach § 828 Abs. 2 ZPO das Amtsgericht, in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemeinen Gerichtsstand hat. Der allgemeine Gerichtsstand der Schuldnerin als juristischer Person wird gem. § 17 Absatz I ZPO durch ihren Sitz bestimmt. Der Sitz der Schuldnerin, einer GmbH, ist gem. § 4a GmbHG der Ort im Inland, den der Gesellschaftsvertrag bestimmt. Das gilt auch, wenn sich der Verwaltungssitz an einem anderen Ort befindet. Notwendig ist die Angabe einer bestimmten Gemeinde im Inland.
Satzungsgemäßer Sitz der Schuldnerin ist, was durch den Handelsregisterauszug bestätigt wird, Berlin.
In Fällen, in denen eine Gemeinde – wie Berlin – in mehrere (Amts-) Gerichtsbezirke zerfällt, sich der satzungsmäßige Sitz einer GmbH aber in der Angabe der Gemeinde erschöpft, ist ein Sitz der Gesellschaft in allen erfassten Amtsgerichtsbezirken, hier in allen Amtsgerichtsbezirken in B, mit der Folge anzunehmen, dass die Gläubigerin das zuständige Gericht gem. § 35 ZPO auswählen kann. Die Ausschließlichkeit nach § 802 ZPO bezieht sich dann auf alle Gemeindegerichte.
Die Gläubigerin hat hier ihr Wahlrecht mit dem Antrag auf Verweisung an das AG Berlin-Charlottenburg ausgeübt.
Sachverhalt: Parteien sind Eigentümer benachbarter Grundstücke. Kl. verlangte von Nachbarin Rückschnitt überhängender Äste. In einem Schlichtungsverfahren kam es nicht zur Einigung. Nachbarin übertrug dann ihr Eigentum auf ihre Tochter. Kl. verklagte Nachbarin und nahmen nach Information über den Eigentumsübergang nach Klagezustellung einen Parteiwechsel vor, nach dem anstatt der Nachbarin nun deren Tochter die Bekl. war.. Das Amtsgericht wies die Klage als unzulässig ab.
(P) War die Klage nach Parteiwechsel auf Beklagtenseite zulässig? Denn das Schlichtungsverfahren wurde mit der Nachbarin und nicht ihrer Tochter durchgeführt.
BGH: Der Parteiwechsel auf Beklagten macht keinen erneuten Schlichtungsversuch erforderlich.
Wegen der geltend gemachten Ansprüche hat bereits ein Schlichtungsversuch stattgefunden. Dass die Schlichtung nur gegenüber der früheren Bekl. versucht worden ist, führt nicht dazu, dass die Klage mit dem Parteiwechsel unzulässig geworden ist. Das Ziel der Entlastung der Zivilgerichte lässt sich nicht mehr erreichen, wenn die Schlichtung erfolglos geblieben und der Rechtsstreit bei Gericht anhängig geworden ist. Daher macht ein Parteiwechsel auf Klägerseite die Klage nicht unzulässig.
Nach dem Scheitern der Schlichtung ist das gerichtliche Verfahren wie jedes andere Verfahren nach den Vorschriften der ZPO durchzuführen. Die klagende Partei kann die Klage erweitern (§ 264 Nummer 2 ZPO) oder nach Maßgabe von § 263 ZPO ändern, ohne dass hierdurch die Zulässigkeit der Klage entfällt. Dies folgt im Übrigen auch daraus, dass § 15a EGZPO die Länder in den in Abs. 1 Nr. 1-3 genannten Fällen nur ermächtigt, die Klageerhebung, nicht aber auch eine Klageerweiterung oder -änderung von der vorherigen Durchführung eines Schlichtungsverfahrens abhängig zu machen.
Für einen Parteiwechsel auf Klägerseite war dies schon länger so entschieden. Die aktuelle Entscheidung erstreckt diese Rspr. auch auf einen Wechsel auf Beklagtenseite.
Sachverhalt: Kl. verklagt Bekl. auf Zahlung vor der 3. Zivilkammer eines Landgerichts. Gericht bejaht grds. den Zahlungsanspruch des Kl., verneint aber den Eintritt einer erforderlichen Bedingung. Folgerichtig wird die Klage im Urteil als „derzeit unbegründet abgewiesen“. In einem Folgeprozess vor der 5. Zivilkammer des gleiches Landgerichts nach Bedingungseintritt wird die Klage abermals abgewiesen, weil „der Anspruch auch aus anderen Gründen als dem fehlenden Bedingungseintritt nicht bestand.“
(P) Konnte das Gericht des Folgeprozesses bzgl. der Annahme des grds. Bestehens/ Nichtbestehens des Anspruchs von dem Vorgericht abweichen oder erstreckte sich die Rechtskraft des Vor-Urteils auf diesen Umstand?
BGH: Rechtskraft erstreckt sich auf die Feststellung des grds. Bestehens des Anspruchs bei fehlendem Bedingungseintritt.
Die Rechtskraft eines Urteils, mit dem eine Klage wegen des fehlenden Eintritts von aufschiebenden Bedingungen als derzeit unbegründet abgewiesen wird, umfasst auch die Gründe des Urteils, soweit in ihnen die übrigen Anspruchsvoraussetzungen positiv festgestellt bzw. bejaht worden sind.
Umstritten war bisher, inwieweit einer Klageabweisung als zurzeit unbegründet neben dieser „negativen“ Rechtskraftwirkung zulasten des Klägers auch eine „positive“ Rechtskraftwirkung dahingehend zukommen kann, dass zugunsten des Klägers das Vorliegen bestimmter Voraussetzungen des Anspruchs feststeht.
Diese positive Rechtskraftwirkung hat der BGH bejaht! Allerdings erwächst nicht der gesamte Urteilsinhalt in Rechtskraft. Die Rechtskraft beschränkt sich vielmehr auf die Rechtsfolge, die den Entscheidungssatz bildet, den das Gericht aus dem Sachverhalt durch dessen Subsumtion unter das objektive Recht erschlossen hat. Bei einer klagabweisenden Entscheidung ist jedoch der aus der Begründung zu ermittelnde, die Rechtsfolge bestimmende, ausschlaggebende Abweisungsgrund Teil des in Rechtskraft erwachsenden Entscheidungssatzes und nicht allein ein Element der Urteilsbegründung.
Denn wenn das Gericht in dem Vorprozess, in dem der Beklagte die unbeschränkte Klageabweisung beantragt, die Voraussetzungen des geltend gemachten Anspruchs bejaht mit Ausnahme des Eintritts von aufschiebenden Bedingungen, handelt es sich bei der Bejahung der Anspruchsvoraussetzungen nicht allein um ein Element der Urteilsbegründung und eine Vorfrage, sondern gemessen an dem Rechtsschutzziel des Beklagten um einen ausschlaggebenden Abweisungsgrund. Der Beklagte, der eine unbeschränkte Klageabweisung beantragt, ist aufgrund seines weitergehenden Rechtsschutzziels beschwert, soweit (lediglich) eine Abweisung als derzeit unbegründet erfolgt.
Entsprechend kann der Beklagte mit einem Rechtsmittel erreichen, dass gerichtlich geprüft wird, inwieweit der geltend gemachte Anspruch unbeschränkt abzuweisen ist, weil er endgültig nicht besteht.
Dann ist es aber folgerichtig, dass die Bejahung der Anspruchsvoraussetzungen „positiv“ zugunsten des Klägers wirkt. Dieses Ergebnis ist auch deswegen überzeugend, weil andernfalls der Kläger in einem Folgeprozess gegebenenfalls gezwungen wäre, die bereits geprüften und bejahten Anspruchsvoraussetzungen nochmals zu beweisen.
Soweit das Gericht des Vorprozesses bei einer Klageabweisung als zurzeit unbegründet wegen des fehlenden Eintritts von aufschiebenden Bedingungen in den Entscheidungsgründen das Bestehen des geltend gemachten Anspruchs – mit Ausnahme des Eintritts von aufschiebenden Bedingungen – bejaht hat, ist es dem Beklagten aufgrund der Rechtskraftwirkung dieses Urteils im Folgeprozess mithin verwehrt, Einwendungen und Einreden gegen das Bestehen des Anspruchs geltend zu machen, die bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung bzw. dem diesem entsprechenden Zeitpunkt des Vorprozesses entstanden sind.
Die Klage kann im Folgeprozess nicht mit der Begründung abgewiesen werden, der Anspruch habe bereits im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung im Vorprozess aus anderen Gründen als denen des fehlenden Eintritts der aufschiebenden Bedingungen nicht bestanden.
Sachverhalt: Kl. hatte Werklohnforderung iHv 2.000,- EUR gg. Bekl. und machte diese nach erfolglosen Mahnungen im gerichtlichen Mahnverfahren durch Beantragung eines Mahnbescheids (§ 688 ZPO) geltend. Nach Einlegung eines Widerspruchs gegen den erlassenen und zugestellten Mahnbescheid zahlte der Bekl. die 2.000,- EUR an den Kl. Nach Widerspruch erfolgte binnen einer Woche Abgabe vom Mahngericht an das Prozessgericht erklärte der Kl. den Rechtsstreit für erledigt. Der Bekl. schloss sich dem nicht an.
(P) Hat sich der Rechtsstreit erledigt? Definition Erledigung: Eine ursprünglich zulässige (1) und begründete (2) Klage ist durch ein nach Rechtshängigkeit eingetretenes Ereignis (3) entweder unzulässig (4) und/oder unbegründet (5) geworden.
Fraglich hier, ob erledigendes Ereignis vor oder nach Rechtshängigkeit?
Nach § 696 Abs. 3 ZPO gilt ein Rechtsstreit mit Zustellung des Mahnbescheids als rechtshängig, wenn nach einem Widerspruch alsbald die Abgabe an das Prozessgericht erfolgt.
Wenn diese Voraussetzung vorliegt, tritt Rechtshängigkeit mit Zustellung des Mahnbescheids und nicht erst mit Eingang der Akten beim Prozessgericht ein.
BGH: Hier ist die Abgabe binnen einer Woche und damit alsbald im Sinne des § 696 Abs. 3 ZPO erfolgt. Daher Erledigung NACH Rechtshängigkeit.
Anwendungsbereich des § 696 Abs. 3 ZPO mit der Rückwirkungsfiktion nicht im Mahnverfahren einschränkbar (arg. Entstehungsgeschichte, Sinn & Zweck).
Ausnahme bei Frage der Zuständigkeit bei Teilrücknahme zwischen Mahnbescheid und Abgabe (Für 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO wird auf den Zeitpunkt des Akteneingangs beim Prozessgericht abgestellt) wirkt nicht bei Frage der Erledigung.
Verwaltungsprozessrecht
Auftritte eines Polizisten in sozialen Medien, in denen er unter dem Namen „Officer X.“ Unterhaltungs- und Talkformate anbietet, die sich mit Themen aus dem polizeilichen Alltag befassen, und dabei auch Gespräche mit Verfahrensbeteiligten oder Personen aus einem kriminalitätsbelasteten Milieu führt, können vom Dienstherrn auf der Grundlage des Rechts der Nebentätigkeiten untersagt werden.
Nach dem einschlägigen Landesrecht ist eine nicht genehmigungspflichtige Nebentätigkeit ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die Beamtin oder der Beamte bei ihrer Ausübung dienstliche Pflichten verletzt.
Das Gericht ist der Auffassung, dass der Antragsteller gegen dienstliche Pflichten aus § 34 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG § 101 LBG verstoßen hat. Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 3 BeamtStG muss das Verhalten innerhalb und außerhalb des Dienstes der Achtung und dem Vertrauen gerecht werden, die der Beruf erfordert. Nach § 101 LBG hat ein Beamter das Ansehen der Polizei und Disziplin zu wahren und sich rückhaltlos für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und für den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Verfassung von Berlin einzusetzen. Der Antragsteller, der u.a. in einem Livestream bejaht, dass er Polizeibeamter ist, zeigt sich dabei in vertrauter Art und Weise. Dies wird insbesondere durch das Duzen der Gesprächsparteien und die lockere Gesprächsatmosphäre belegt (der eine offenbar auf dem Hometrainer und der andere zurückgelehnt aus der Sportflasche trinkend), in einem Livestream mit einem Beschuldigten in einem laufenden und in der Öffentlichkeit sehr präsenten Strafprozess. Bei dem von ihm gewählten Gesprächspartner handelt es sich dabei um einen polizeibekannten mutmaßlichen „Clan-Chef“. Auch wenn dieser – wie in dem Video mehrfach betont wird – nicht vorbestraft ist, suggeriert das Video ein in Ansehung des Berufsstandes des Antragstellers inakzeptables Näheverhältnis, das nicht nur geeignet ist, das Ansehen der Polizei zu schädigen, sondern vorliegend bereits zu einer erheblichen Schädigung geführt hat.
Art. 8 Abs. 1 GG gewährleistet nicht nur die Freiheit, an einer öffentlichen Versammlung teilzunehmen oder ihr fern zu bleiben, sondern umfasst zugleich ein Selbstbestimmungsrecht über die Durchführung der Versammlung als Aufzug, die Auswahl des Ortes und die Bestimmung der sonstigen Modalitäten.
EGL hier: Art. 15 BayVersG: Behörde kann Versammlung verbieten oder von bestimmten Auflagen abhängig machen, wenn nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.
Aber: „im Lichte der grundlegenden Bedeutung von Art. 8 Abs. 1 GG auszulegen“.
„öffentliche Sicherheit“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 BayVersG umfasst die gesamte Rechtsordnung, darunter auch die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs und die in diesem Zusammenhang betroffenen Rechte Dritte
Herstellung praktischer Konkordanz erforderlich
wichtige Abwägungselemente: Dauer und Intensität der Aktion, Ausweichmöglichkeiten, Dringlichkeit der blockierten Tätigkeit Dritter, aber auch der Sachbezug zwischen den beeinträchtigten Dritten und dem Protestgegenstand
Auch Bundesfernstraßen sind, obwohl sie von ihrem eingeschränkten Widmungszweck her anders als andere öffentliche Verkehrsflächen nicht der Kommunikation dienen, sondern ausschließlich dem Fahrzeugverkehr, nicht generell ein „versammlungsfreier Raum“
Zwar darf hier den Verkehrsinteressen im Rahmen von versammlungsrechtlichen Anforderungen nach Art. 15 Abs. 1 BayVersG erhebliche Bedeutung beigemessen werden
Die Einstufung einer Straße als Bundesautobahn oder Bundesstraße entscheidet allerdings nicht darüber, ob auf dieser Straße grundsätzlich eine Versammlung stattfinden darf und entbindet Versammlungsbehörden und Gerichte nicht von einer Güterabwägung
Ausgehend davon wurde Eilantrag gegen Versammlungsverbot stattgegeben wegen defizitärer Gefahrenprognose der Versammlungsbehörde (Frage des Einzelfalls).
Wichtig: Rechtslage in NRW ist eine andere: § 13 Abs. 1 Satz 3 Versammlungsgesetz NRW: „Auf Bundesautobahnen finden keine Versammlungen statt.“ OVG NRW dazu bisher (nur) in einem Eilverfahren (Beschluss vom 29. Juli 2022 – 15 B 897/22): „Dass die Verbotsnorm des § 13 Abs. 1 Satz 3 VersG NRW mit überwiegender Wahrscheinlichkeit wegen Verstoßes gegen das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 GG unwirksam ist, ist aktuell nicht feststellbar. Dies gilt bereits mit Blick auf den Schutzbereich dieses Grundrechts. Zwar wird in der obergerichtlichen Rechtsprechung teilweise vertreten, dass der Schutzbereich des Versammlungsrechts auch Versammlungen auf Bundesautobahnen erfasst. Es finden sich aber auch ablehnende Stimmen.“
Eine Klageänderung ist in der Regel nicht sachdienlich, wenn der Rechtsstreit über die geänderte Klage verwiesen werden muss. Bei einer unzulässigen Klageänderung in Form einer nachträglichen kumulativen Klagehäufung ist die geänderte Klage durch Prozessurteil abzuweisen.
Bei einem gerichtlichen Eingangsstempel handelt es sich um eine öffentliche Urkunde (§ 98 VwGO i.V.m. § 418 Abs. 1 ZPO in entsprechender Anwendung). Als solche begründet der Eingangsstempel grundsätzlich aus sich heraus den vollen Beweis dafür, dass eine Klageschrift an dem aus dem Stempel ersichtlichen Datum bei Gericht eingegangen ist.
Der Unterbringungsanspruch eines Obdachlosen nach § 14 Abs. 1 OBG NRW ist grundsätzlich auf die Unterbringung in einer menschenwürdigen Unterkunft gerichtet, die Schutz vor den Unbilden der Witterung bietet sowie Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse lässt. Dabei müssen Obdachlose im Verhältnis zur Versorgung mit einer Wohnung weitgehende Einschränkungen hinnehmen. Allerdings kommt es immer auch auf die Einzelfallumstände an. Die zugewiesene Unterkunft muss insbesondere den schutzwürdigen Belangen von minderjährigen Kindern Rechnung tragen und nach ihrem Zuschnitt Rückzugsmöglichkeit für einzelne Familienangehörige bieten. Zu einer menschenwürdigen Unterbringung gehört auch, dass dem Unterzubringenden eine gewisse Mindestfläche zur Verfügung steht. Dabei kann im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung auch berücksichtigt werden, ob es sich um eine absehbar nur kurzfristige oder um eine längerfristige obdachmäßige Unterbringung handelt. Für eine längerfristig obdachlose fünfköpfige Familie ist eine 30 qm große Unterkunft nicht ausreichend.
Gegen friedliche Versammlungen darf nur unter den besonderen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands eingeschritten werden. Die Annahme des polizeilichen Notstands setzt voraus, dass die Gefahr auf andere Weise nicht abgewehrt und die Störung auf andere Weise nicht beseitigt werden kann und die Verwaltungsbehörde nicht über ausreichende eigene, eventuell durch Amts- und Vollzugshilfe ergänzte, Mittel und Kräfte verfügt, um die gefährdeten Rechtsgüter wirksam zu schützen. Ein Einschreiten kommt in Betracht, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die Versammlungsbehörde wegen der Erfüllung vorrangiger staatlicher Aufgaben und gegebenenfalls trotz Heranziehung externer Polizeikräfte zum Schutz der angemeldeten Versammlung nicht in der Lage wäre.
Mit der in einer Corona-Schutzverordnung enthaltenen Verpflichtung von Teilnehmern eine Gerichtsverhandlung, Name und Anschrift in eine Liste einzutragen, wird die Gerichtsöffentlichkeit nach § 169 GVG nicht unzulässig eingeschränkt. Denn die zeitlich kurz befristete Erfassung der Personalien zum alleinigen Zweck der Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter für den Fall, dass im Nachhinein eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bei den Teilnehmern einer Gerichtsverhandlung festgestellt wird, ist als eine zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zulässige und auch nicht unverhältnismäßige Maßnahme gemäß § 32 Satz 1 IfSG i.V.m. § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG anzusehen, die den Zugang der Öffentlichkeit zu öffentlichen Gerichtsverhandlungen, aber auch den der Verfahrensbeteiligten hierzu weder unzulässig noch unzumutbar einschränkt. Dass einzelne Interessenten sich veranlasst sehen könnten, allein wegen der Registrierung ihrer Personalien zum genannten Zweck des Gesundheitsschutzes von einer beabsichtigten Teilnahme an einer öffentlichen Gerichtsverhandlung Abstand zu nehmen, ist schon nicht erkennbar, jedenfalls kommt nicht jede sich als psychologische Hemmschwelle auswirkende Maßnahme einer Verweigerung des Zutritts gleich.
Enthält eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft eine längere Frist als die gesetzlich vorgesehene, so ist die längere Frist maßgeblich, nicht hingegen die Jahresfrist des § 58 Abs. 2 VwGO. Der Rechtsbehelf kann demnach in diesen Fällen bis zum Ablauf der in der Belehrung fehlerhaft benannten längeren Frist fristwahrend eingelegt werden. Die Frist darf jedoch nicht die Jahresfrist des § 58 Abs. 2 VwGO übersteigen.
Strafprozessrecht
Ein Schöffe teilt der Kammer kurz vor dem achten Hauptverhandlungstag mit, er nehme eine Einschlafhilfe, dessen Wirkung erst vormittags nachlasse. Daher sei er an den bisherigen Prozesstagen „nur zu 80% anwesend“ gewesen. Zuvor hatte er die Kammer angelogen und Müdigkeitserscheinungen bestritten. Die Hauptverhandlung wird an dem Tag normal durchgeführt. Anschließend erstattet der Schöffe eine Selbstanzeige. Die Verfahrensbeteiligten wurden informiert, stellten jedoch kein Ablehnungsgesuch. Kurz danach schließt die Kammer den Schöffen wegen Befangenheit aus. Grund sei nicht die Müdigkeit, sondern die Lüge.
Mit der Revision (relativer Revisionsgrund) wurde ein Verstoß gegen die Wartepflicht aus § 29 Abs. 1 StPO gerügt, also die Befugnis, nach einem Ablehnungsgesuch nur unaufschiebbare Amtshandlungen vorzunehmen. Dafür müsste die Norm zunächst – über den Wortlaut hinaus – auf den Richter anzuwenden sein, der eine Selbstanzeige erstattet hat. Der BGH brauchte das nicht zu entscheiden, da, selbst wenn man das bejahen würde, auch § 29 Abs. 2 S. 1 StPO gelten und sich die Wartepflicht nicht auf die Hauptverhandlung erstrecken würde. Nur das würde der gesetzgeberischen Wertung (das öffentliche Interesse an der beschleunigten Durchführung der Hauptverhandlung geht vor) entsprechen.
Die Frage, ob § 29 Abs. 1 StPO nach einer Selbstanzeige anzuwenden ist, müsste entschieden werden, wenn eine andere Amtshandlung als die Durchführung der Hauptverhandlung vorgenommen worden wäre. Der BGH neigt im Wesentlichen aus folgenden Gründen zur Ablehnung der Anwendbarkeit.
- Die Verfahrensbeteiligten haben es in der Hand, durch ein Ablehnungsgesuch – ihnen ist zu der Selbstanzeige rechtliches Gehör zu gewähren – die direkte Anwendung des § 29 Abs. 2 StPO herbeizuführen. Tun sie dies nicht, haben sie zum Ausdruck gebracht, keine Bedenken gegen die weitere Mitwirkung des Richters/Schöffen zu haben. Dann haben sie auch kein schützenswertes Interesse an einer Wartepflicht.
- Auch das Recht auf den gesetzlichen, also unbefangenen Richter aus Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG gebietet nicht die analoge Anwendung, sondern verpflichtet „nur“ den Gesetzgeber, überhaupt Regelungen zum Ausschluss eines Richters zu schaffen. Die Ausgestaltung ist seine Sache.
- Das gesetzgeberisch vorgesehene Stufenverhältnis von Ausschlussgründen nach §§ 22, 23, 148a Abs. 2 S. 1 StPO (absolut, unabhängig von einem Antrag sowie unverzichtbar) einerseits und Befangenheit (Ausschluss erst mit Beschluss, nur auf Antrag, nicht von Amts wegen sowie verzichtbar und sogar ggf. präkludiert nach § 25 StPO) andererseits wäre unhaltbar, wäre der abgelehnte Richter schon vor der Entscheidung über seine Befangenheit nicht mehr gesetzlicher Richter.
- Die unterschiedliche Ausgestaltung des Verfahrens nach Ablehnung (§§ 24 ff. StPO) und nach einer Selbstanzeige (§ 30 StPO) entspricht der gesetzgeberischen Grundkonzeption. Dies zeigt sich vor allem bei § 338 Nr. 3 StPO, der nur nach einer Ablehnung wegen Befangenheit anwendbar ist.
Gemäß § 22 Nr. 5 StPO darf ein Richter nicht (mehr) mitwirken, wenn er in der Sache als Zeuge oder Sachverständiger vernommen ist. Tut er es doch, liegt der absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 2 StPO vor. Wie ist „in der Sache“ zu definieren?
Der Angeklagte war ursprünglich gemeinsam mit zwei weiteren Personen angeklagt, bevor sich herausstellte, dass er noch Heranwachsender war. Das Verfahren gegen ihn wurde daher abgetrennt. Derselbe Sachverhalt wurde also nun zeitgleich vor einer Erwachsenen- und einer Jugendkammer verhandelt.
Der Vorsitzende der Jugendkammer wurde im Prozess vor der Erwachsenenkammer als Zeuge zu den Angaben des Geschädigten vernommen, die er vor der Jugendkammer gemacht hatte, um mögliche Widersprüche aufzuklären.
Durfte er daraufhin weiterhin Teil der Jugendkammer sein? Der BGH hat entschieden: Nein! Wegen § 22 Nr. 5 StPO.
„In der Sache“ setzt keine Verfahrensidentität voraus! Sie ist auch dann gegeben, wenn ein Richter in einem anderen Verfahren zu demselben Tatgeschehen förmlich vernommen worden ist, das er jetzt abzuurteilen hätte. Die Vernehmung muss sich nicht auf eigene Wahrnehmungen zum Tatgeschehen beziehen. Es genügt, wenn sie Umstände thematisiert, die der Richter auch in dem ihm vorliegenden Verfahren im Hinblick auf Schuld- und Straffrage in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bewerten muss.
Gemäß § 32d S. 1 StPO muss die Revision schriftlich eingelegt und begründet werden. Der BGH hat dafür folgende Formvoraussetzungen festgelegt:
- (Einfache) Signierung = maschinenschriftliche Anbringung des bürgerlichen Namens unterhalb des Textes oder eingescannte – lesbare – Unterschrift (aber nicht erforderlich!)
- Nachname genügt, wenn voller Name anderer Stelle des Schriftsatzes zu entnehmen und Verwechslungen ausgeschlossen
- Zusatz „Rechtsanwalt“ nicht erforderlich
- Nur „Rechtsanwalt“ genügt nicht, wenn sich allein daraus keine bestimmte Person zuordnen lässt, die Verantwortung für den Inhalt der Revisionsbegründungsschrift übernimmt
- Postfach des RA, der in der Signatur als verantwortende Person erscheint
- Einfache Signierung eines Kollegen genügt nur, wenn er als allgemeiner Vertreter nach § 53 Abs. 2 S. 1 BRAO tätig wird oder selbst vom Angeklagten bevollmächtigt wird (Untervollmacht durch Pflichtverteidiger unwirksam)
- Dieser RA ist der Versender (nicht etwa Kanzleimitarbeiter o.Ä.)
Für eine Ausnahme nach § 32d S. 3 und 4 StPO genügt eine stichwortartige Zustandsbeschreibung oben auf der ersten Seite (hier „per Fax da beA derzeit hier ohne Funktion) genügt nicht. Aus dem Schriftsatz muss sich ergeben, dass eine grundsätzlich einsatzbereite technische Infrastruktur existiert und eine nur vorübergehende Störung gegeben ist
Um Transparenz zu schaffen und das mit einer Verständigung verbundene Geschehen zu dokumentieren, sind die zwischen den Verfahrensbeteiligten außerhalb der Hauptverhandlung geführten Gespräche öffentlich bekannt zu machen.
Die Mitteilung hat möglichst umgehend zu erfolgen: über Gespräche vor der Verhandlung nach Verlesung des Anklagesatzes (§ 243 Abs. 4 Satz 1 StPO), über Gespräche nach Prozessbeginn, aber außerhalb der Verhandlung alsbald nach der Fortsetzung.
Inhaltlich muss Folgendes mitgeteilt werden:
- Gab es Gespräche: ja oder nein?
- Teilnehmer des Gesprächs
- Von wem ging die Initiative aus?
- Wesentlicher Inhalt des Gesprächs
- Jeweilige Standpunkte
- Jeweilige Zustimmung oder Ablehnung
Werden Gespräche zwischen den Verfahrensbeteiligten in öffentlicher Hauptverhandlung geführt, gelten andere Mitteilungspflichten, da es hier nicht darum geht, Transparenz zu schaffen und informellen Absprachen einen Riegel vorzuschieben. Was muss protokolliert werden?
Scheitern die Verständigungsgespräche, muss nur der Vermerk aufgenommen werden, dass eine Verständigung nicht stattgefunden hat (§ 273 Abs. 1a S. 3 StPO). Der Inhalt der Gespräche muss nicht protokolliert werden, da in der Verhandlung geführte Gespräche ihrem Wesen nach der Kenntnis und Kontrolle aller Verfahrensbeteiligten und der Öffentlichkeit unterliegen.
Kommt eine Verständigung zustande (§ 257c StPO), muss das Protokoll den wesentlichen Ablauf, Inhalt und Ergebnis einer Verständigung wiedergeben (§ 273 Abs. 1a StPO).
Während einer Zeugenvernehmung wurde infolge eines Alarms das Gerichtsgebäude abgeriegelt, also alle Eingangstüren zum Gebäude verschlossen. Der Vorsitzende fragt den Wachtmeister, ob ein Sicherheitsrisiko bestehe. Als dieser verneinte, wurde fortgesetzt.
Der absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 6 StPO liegt nur vor, wenn das Gericht oder der Vorsitzende eine die Öffentlichkeit unzulässig beschränkende Anordnung trifft oder eine bekannte Beschränkung nicht beseitigt.
Wird die Öffentlichkeit nicht durch eine richterliche Anordnung, sondern durch ein tatsächliches Hindernis beschränkt, ist die Revisionsrüge nur erfolgreich, wenn dem Gericht die faktische Beschränkung bekannt war oder es diese bei ordnungsgemäßer Sorgfalt hätten erkennen und beseitigen können.
Ersteres traf nicht zu. Der Vorsitzende hat in einer dienstlichen Erklärung zur Revisionsbegründung ausgeführt, ihm sei die Schließung der Türen bis zu einer späteren Mitteilung der Hausverwaltung nicht bekannt gewesen. (Da es sich nicht um eine wesentliche Förmlichkeit handelt, war dies im Freibeweis zu klären.)
Hätte der Vorsitzende die faktische Beschränkung bei ordnungsgemäßer Sorgfalt erkennen und beseitigen müssen? Zwar kann es für das Gericht im Einzelfall geboten sein, sich von der Wahrung der Öffentlichkeit zu überzeugen, etwa durch Einholung von Auskünften bei den Wachtmeistern. Die Anforderungen, die in dieser Hinsicht an die Aufmerksamkeit des Vorsitzenden zu stellen sind, dürfen aber auch nicht überspannt werden. Es muss berücksichtigt werden, dass ihm gerade in der mündlichen Verhandlung eines Strafprozesses mannigfache Aufgaben übertragen sind, die in hohem Maße seiner Aufmerksamkeit bedürfen.
Der Wachtmeister wies den Vorsitzenden nicht auf die Schließung der Zugangstüren hin. Ohne gegenteilige Anzeigen durfte das Gericht davon ausgehen, dass der Zugang zum Gebäude und zum Sitzungssaal trotz des Alarms uneingeschränkt möglich war.
Der BGH hat daher § 338 Nr. 6 StPO verneint.
Der 2. Strafsenat hatte bisher angenommen, dass § 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB die Strafbarkeit aus § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB verdrängt. Nun „neigt“ er wie der 3. Senat und Teile der Literatur zu Tateinheit auch zwischen § 226 Abs. 1 Nr. 3 und § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB – wegen des spezifischen Tatunrechts, das mit dem wissentlichen und willentlichen Einsatz einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs verbunden sei.
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Angeklagte schlug dem Opfer mehrfach mit einer Glasflasche auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt u.a. Blutungen im Hirn und ist infolge der Tat bettlägerig, pflegebedürftig und wird über eine Magensonde ernährt. Der Angeklagte wurde wegen §§ 224 Abs. 1 Nrn. 2 und 5, 226 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 2, 52 StGB verurteilt. Einen Tötungsvorsatz vermochte das Landgericht nicht festzustellen.
Ist in folgendem Fall der besonders schwere Fall der Urkundenfälschung nach § 267 Abs. 3 Nr. StGB (der Täter führt einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbei) erfüllt? Die Beschuldigte versteckt während ihrer Arbeitszeit fast acht Millionen Euro in einem Rollcontainer, bringt das Geld damit durch die Sicherheitsschleuse aus dem Firmengebäude, verlud den Container auf dem Firmenhof gemeinsam in einen Kleintransporter mit kurz zuvor gestohlenen Kfz-Kennzeichen (§ 267 Abs. 1 StGB!) und flüchtete mit dem Fahrzeug und der Diebesbeute.
Der Revisionsführer verlangte hier für § 267 Abs. 3 StGB einen Unmittelbarkeitszusammenhang zwischen der Urkundenfälschung durch Verwendung gestohlener Kfz-Kennzeichen am Tatfahrzeug, also der Tathandlung des § 267 Abs. 1 StGB, und dem durch die (Diebstahls-)Tat herbeigeführten Schaden, also dem Vermögensverlust.
Anknüpfungspunkte war die Frage der Verwertbarkeit der Erkenntnisse aus einer Aufzeichnung der Telekommunikation nach § 100a StPO (für die Revision Widerspruch in der Hauptverhandlung erforderlich!). Voraussetzung ist eine erhebliche Straftat nach § 100a Abs. 2 Nr. 1r StPO, also ein besonders schwerer Fall nach § 267 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StGB.
Der BGH hat die Norm ausgelegt und das Erfordernis eines Unmittelbarkeitszusammenhangs abgelehnt:
- Im Wortlaut „Herbeiführen eines Vermögensverlustes“ findet sich keine Unmittelbarkeit.
- In den Gesetzgebungsmaterialien gibt es dafür ebenfalls keine Anhaltspunkte.
- Systematik: auch bei § 267 Abs. 2 Nr. 1 StGB ist keine Unmittelbarkeit erforderlich, also dass der Täter seine Einnahmen unmittelbar aus der Urkundenfälschung selbst erzielen müsste
- Sinn und Zweck: ein derart enges Normverständnis, wenn man einen Unmittelbarkeitszusammenhang verlangen würde, würde den praktischen Anwendungsbereich ausschließen.
Ein mittelbarer Zusammenhang zwischen dem Urkundsdelikt und dem Schaden genügt. Ein solcher wäre wohl zu verneinen, wenn der Diebstahl vollendet ist, also mit der Wegnahme. Dazu bedurfte es hier noch des Abtransports mit dem Tatfahrzeug. Der Gebrauch der unechten zusammengesetzten Urkunde diente tatplangemäß dem Abtransport der Tatbeute und der Verhinderung der Tatentdeckung, was zu einer Sicherung des Diebesguts und damit zu einem endgültigen Vermögensverlust führen sollte
Die Vernehmung eines Zeugen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit nach § 171b GVG statt. Nach dessen Entlassung wurde ein weiterer Zeuge hereingerufen und belehrt. Erst anschließend wurde die Öffentlichkeit wiederhergestellt (§§ 272 Nr. 5, 274 StPO) und der Zeuge vernommen. Dies ergab sich aus dem Protokoll (absolute Beweiskraft!).
Die Zeugenbelehrung fand ohne Öffentlichkeit unter Verstoß gegen § 169 Abs. 1 S. 1 GVG i.V.m. § 57 S. 1 und 2 StPO statt. Der absolute Revisionsgrund § 338 Nr. 6 StPO liegt grundsätzlich vor.
Ganz ausnahmsweise erfolgt jedoch dennoch keine Aufhebung des Urteils, wenn ein Einfluss des Verfahrensfehlers auf das Urteil, also ein Beruhen, unter jedem denkbaren Gesichtspunkt ausgeschlossen ist. So lag der Fall hier:
- Das Gericht hat allein die Angaben des Zeugen zugrunde gelegt, die er in öffentlicher Hauptverhandlung gemacht hat.
- Der Zeuge wurde belehrt, so dass der Aussageinhalt nicht beeinflusst wurde.
§ 57 ist lediglich eine Ordnungsvorschrift, die dem Schutz des Zeugen dient und den Rechtskreis des Angeklagten nicht berührt, so dass auf das Unterbleiben der Belehrung eine Revision nicht gestützt werden kann. Um einen Wertungswiderspruch zu vermeiden, muss dies erst recht gelten, wenn Zeugen lediglich unter Verstoß gegen § 169 Abs. 1 S. 1 GVG belehrt worden sind.
- 229 StPO regelt, wie lange eine Hauptverhandlung unterbrochen, also pausiert, werden darf. Abs. 3 bestimmt, dass ggf. länger unterbrochen werden darf, wenn ein Richter, Schöffe oder Angeklagter krank wird, da der Fristlauf gehemmt ist. Die Berechnung der Fristen und der Verstoß gegen die Norm (relativer Revisionsgrund) sind in der Praxis häufig problematisch.
Der BGH hatte sich nun mit der Frage zu befassen, ob die Unterbrechungsfristen auch gehemmt sind, wenn ein Ergänzungsschöffe vor dessen Eintritt in das Quorum krank wird. Ergänzungsschöffen (§ 192 Abs. 2 GVG) sind Laienrichter, die bei voraussichtlich langer Verfahrensdauer vorsorglich von Beginn an im Saal an jedem Hauptverhandlungstag, aber nicht an Beratungen usw. teilnehmen, um bei Verhinderung eines Hauptschöffen nachrücken und dessen Aufgaben übernehmen zu können.
Der BGH hat die Norm schulmäßig auslegt
- Wortlaut: „zur Urteilsfindung“ – nicht zur Entscheidung – berufene Person
- Systematik: § 299 im Abschnitt über die Hauptverhandlung (daran nimmt Ergänzungsschöffe in jedem Fall teil)
- Wille des Gesetzgebers und Sinn und Zweck: Ressourcenschonung und Vermeidung einer Aussetzung (Neustart und vollständige Wiederholung)
und kommt zu dem Ergebnis, dass die Unterbrechungsfrist auch bei Erkrankung eines Ergänzungsschöffen gehemmt ist.
Liegt ein Verstoß gegen § 243 Abs. 5 S. 1 StPO (relativer Revisionsgrund) vor, wenn der Angeklagte nicht vor Zustandekommen einer Verständigung über sein Schweigerecht belehrt wurde? Nein!
Nach dem Wortlaut des § 243 StGB hat eine Belehrung zwischen der Mitteilung nach Abs. 4 S. 1 und Vernehmung zur Sache zu erfolgen. Eine Belehrung über das Schweigerecht für den Fall, dass vor der Vernehmung Erörterungen über eine mögliche Verständigung geführt werden sollen, sieht die Norm nicht vor.
Der Gesetzgeber sah sich auch nicht veranlasst, für diesen Fall eine Belehrung über Schweigerecht vorzusehen, wobei ihm klar war, dass es auch zu diesem Zeitpunkt zu einer Verständigung kommen kann, da die Verständigung gerade dazu dient, die Beweisaufnahme abzukürzen, und deshalb regelmäßig zu Beginn der Hauptverhandlung getroffen wird.
Dies entspricht Sinn und Zweck des § 243 Abs. 5 S. 1 StPO (Selbstbelastungsfreiheit vor Augen führen). Diese wird nicht berührt, wenn Erörterungen stattfinden, die in eine Verständigung münden, da der Angeklagte in diesem Zusammenhang gar keine Angaben zur Sache macht. Das Einverständnis mit dem Verständigungsvorschlag stellt keine Einlassung dar
Für die Dauer einer Zeugenvernehmung kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, wenn Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten, eines Zeugen oder Verletzten zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde, und das öffentliche Interesse an der Erörterung dieser Umstände nicht überwiegt. In dem Fall muss die Öffentlichkeit auch von Amts wegen für die Dauer der Plädoyers ausgeschlossen werden. Andernfalls liegt eine Verletzung des § 171b Abs. 3 GVG (relativer Revisionsgrund) vor.
Darauf beruht das Urteil auch regelmäßig, da nicht auszuschließen ist, dass sich der Angeklagte in seinem letzten Wort (anders) geäußert hätte, wenn ihm dieses unter Ausschluss der Öffentlichkeit erteilt worden wäre.
Das Beruhen wird auch nicht durch die Überlegung ausgeschlossen, dass man einem so späten Geständnis die strafmildernde Wirkung absprechen könnte, da es nicht auf Unrechtseinsicht und Reue beruhen würde, sondern auf erdrückenden Beweisen, oder wäre rein prozesstaktisch motiviert. Dies wäre nämlich die genau zu begründende Ausnahme. Regelmäßig ist ein Geständnis ein bestimmender Strafmilderungsgrund und man darf nicht allein aus dem Zeitpunkt auf prozesstaktische Motivation schließen.
Eine Schöffin kommt zu spät, bittet die Vorsitzende um Rechtsberatung, äußerte in einem Parallelverfahren, das Verfahren hier „gehe ihr nicht so nah, weil der Angeklagte mit seinem Verteidiger rumsitze und Bonbons fresse“ und schließlich ist ein Ermittlungsverfahren gegen sie anhängig, in dem sie von der Rechtsanwältin verteidigt wird, die im Parallelverfahren die Nebenklage vertritt und mit der sie sich nach der Hauptverhandlung besprochen hat. Die Kammer teilt Verfahrensbeteiligten diese Umstände mit, man prüfe eine Befangenheit der Schöffin. Diese gibt eine Stellungnahme dergestalt ab, das gegen sie geführte Ermittlungsverfahren habe mit dem vorliegenden Strafverfahren nichts zu tun und sie fühle sich nicht befangen.
Ein Ablehnungsgesuch gibt es weder von Seiten der Verteidigung noch der StA. Es folgt ein Gerichtsbeschluss, durch den die Schöffin von Amts wegen ausgeschlossen wurde. Die Verhandlung wird mit dem Ergänzungsschöffen fortgesetzt.
- Zulässigkeit der Revision:
Eigentlich ist ein Beschluss, durch den ein Richter ausgeschlossen wird, nach § 28 Abs. 1 StPO unanfechtbar, also die Revisionsrüge unzulässig, § 336 StPO. Allerdings wird immer eine Willkürprüfung durchgeführt. Zu prüfen ist also, ob die Anwendungsvoraussetzungen der Norm verkannt wurden und so in objektiv willkürlicher Weise in die Gerichtsbesetzung eingegriffen wurde.
So lag der Fall hier. Es lagen ganz ersichtlich weder die Voraussetzungen des § 24 StPO (Befangenheitsgesuch der Verfahrensbeteiligten) noch des § 30 StPO (Selbstanzeige oder Ausschluss kraft Gesetzes nach §§ 22, 23 StPO) – jeweils in Verbindung mit § 31 StPO – vor. Hier wurden die Voraussetzungen des § 30 StPO verkannt, nämlich dass von Amts wegen nur eine Überprüfung der gesetzlichen Ausschlussgründe nach §§ 22, 23 StPO stattfindet.
- Begründetheit der Revision
Anknüpfungspunkt ist der absolute Revisionsgrund des § 338 Nr. 1 StPO (nicht vorschriftsgemäße Gerichtsbesetzung). Da weder eine Selbstanzeige noch ein gesetzlicher Ausschlussgrund der §§ 22, 23 StPO vorlag, wurde die Schöffin von der Mitwirkung zu Unrecht ausgeschlossen. Die Kammer war nicht mehr vorschriftsmäßig besetzt.
Das OLG Hamm hat eine weitere wichtige Variante der examensrelevanten EC-Karten-Fälle entschieden: Bezahlt jemand unbefugt mit einer fremden EC-Karte durch einfaches Auflegen auf das Kartenlesegerät (near field communication-Technologie – „NFC“) ohne Eingabe einer PIN und ohne Leistung einer Unterschrift, macht er sich nach § 274 Abs. 1 Nr. 2 StGB strafbar. Er löscht bzw. verändert durch Überschreiben beweiserhebliche Daten, nämlich die Höhe des Verfügungsrahmens sowie die Umständen der bisherigen Karteneinsätze seit der letzten PIN-Abfrage (Anzahl der bisherigen Einsätze im kontaktlosen Bezahlverfahren ohne PIN-Abfrage und Höhe der jeweiligen Zahlbeträge).
303a tritt zurück. § 263 StGB ist mangels Täuschung und Irrtum nicht erfüllt, da die Berechtigung des kartenvorlegenden Kunden für die Entstehung des Zahlungsanspruchs des Händlers gegen die Bank unerheblich ist. § 263a StGB scheitert an der für die Unbefugtheit der Verwendung der Daten erforderlichen Betrugsähnlichkeit. Ein menschlicher Bankangestellter würde keinem Irrtum über die Berechtigung unterliegen, da diese nicht überprüft werde, sondern nur die Einhaltung des Verfügungsrahmens, die Nicht-Eintragung in eine Sperrdatei und das Vorliegen der Voraussetzungen für das Absehen von der starken Kundenauthentifizierung. Für §§ 269 Abs. 1, 270 StGB fehlt es an einer Datenurkunde. Der Aussteller der Gedankenerklärung (das sind die Transaktionsdaten wie Kontonummer und Gültigkeitsdatum der ec-Karte) ist nicht erkennbar. Das kann bei der kontaktlosen Zahlung jeder sein (anders bei Unterschrift oder Pin – beides würde man dem berechtigten Karteninhaber zuordnen).
Auch der BGH wies in seinem Beschluss v. 6.7.2022 – 2 StR 53/22 – erneut darauf hin, dass beim Einsatz entwendeter EC- bzw. Kreditkarten in Ladengeschäften nach der Art der Legitimation zu unterscheiden ist.
Stimmen von Teilnehmern
„Einbeziehung kleiner Fälle und aktueller Rechtsprechung sehr gelungen.“

„Besonders positiv v.a. die Verweise auf aktuelle Rspr. und mögliche Klausurkonstellationen.“

„Richtig gute Veranstaltung!“

„Der Königsweg zum Prädikatsexamen.“

„Aktuelle Rechtsprechung direkt am betreffenden Prüfungspunkt eingebaut.“

„Sehr guter Überblick über den Stoff!“

„Sehr gutes Skript zur Nachbearbeitung!“

„Eine sehr gelungene Ergänzung der Examensvorbereitung.“

„Fazit: Sehr gut!“

„War sehr hilfreich“

„Gerne mehr davon!“

„Es wurde gut auf individuelle Fragen eingegangen“

„Didaktisch sehr gut“

„Vollends zufrieden!“

„Leicht zu folgen und gute Darstellung“

„Motivierende Art und Weise der Ansprache“

„Angenehmes Tempo, guter Aufbau“

Kontakt und Kursbuchungen
Sie haben Fragen oder möchten einen Kurs buchen, dann schreiben Sie uns: